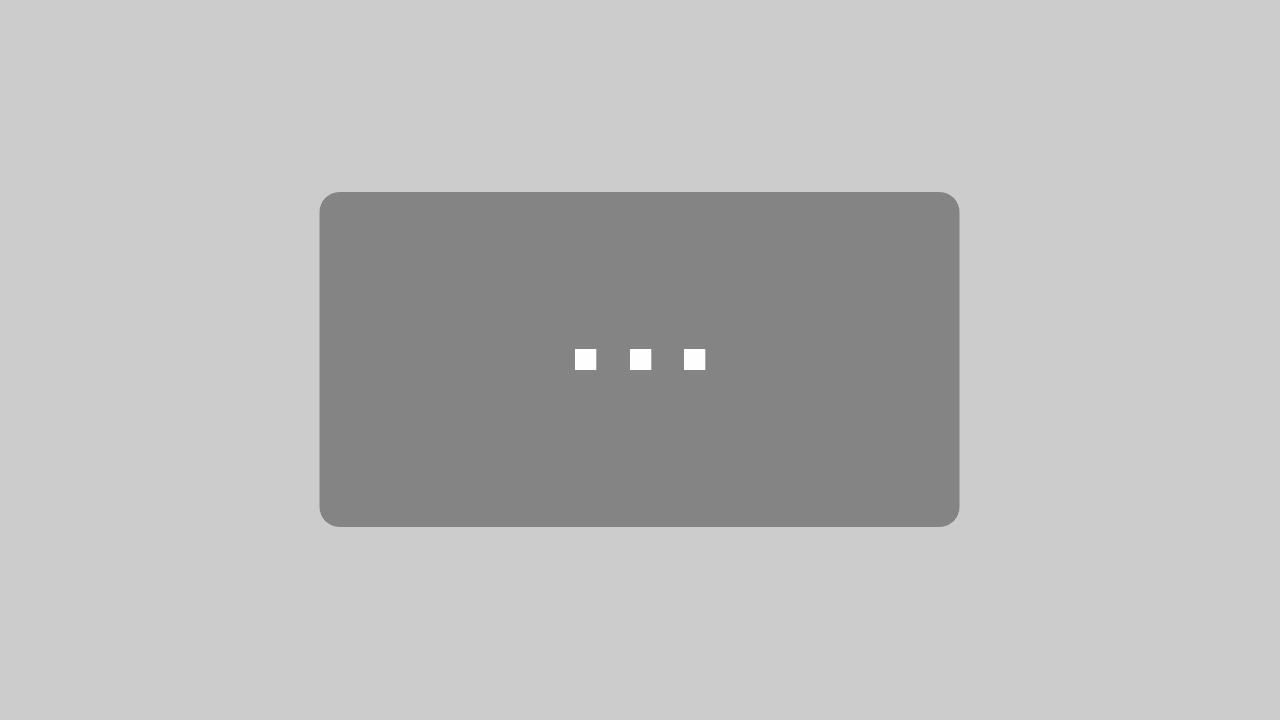Kommentar Umfrage zur Umfrage zum Nationalpark Steigerwald
Solange die Diskussionen um die Einrichtung eines dritten Nationalparks in Bayern im fränkischen Steigerwald läuft, wird immer wieder versucht mit Umfragen den vermeintlichen Volkswillen herauszustellen.
Nun präsentiet das Institut Kantar Public im Auftrag mehrerer Umweltschutzverbände aus dem Nationalpark Bündnis Bayern, darunter der Bund Naturschutz, Greenpeace und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz das Ergebnis einer neuen Umfrage: Bayernweit würden 73% der Menschen einen dritten Nationalpark befürworten. Die ablehnende Haltung der Staatsregierung stünde somit im Widerspruch zur Mehrheit im eigenen Bundesland, ja sogar im Widerspruch zum Willen der Mehrheit der Wähler der CSU.
Dies ist kritisch zu hinterfragen:
1.) Reichweite.
Bayernweit wurden 1000 Personen befragt, den Angaben zufolge ist die Stichprobe repräsentativ. Außer acht gelassen wird dabei die besondere Betroffenheit der in den Regionen ansässigen Menschen. Befragt wurden Personen in ganz Bayern. Während viele Menschen einen Nationalpark aus urbanen Gegenden anreisend als Besuchsort erleben würden, wären die Menschen in der Region selbst viel stärker mit den negativen Folgen konfrontiert, etwa den um sich greifenden Waldschäden oder dem Arbeitsplatzverlust im strukturschwächeren ländlichen Raum.
2.) Suggestive Fragestellung
Die erste gestellt Frage lautete:
»Fänden Sie es gut oder schlecht, wenn in Bayern mehr Wälder als Naturwald geschützt werden?«
Die zweite Frage im Anschluss dann:
»Fänden Sie es gut oder schlecht, wenn in Franken ein Nationalpark Steigerwald im Staatswald eingerichtet wird?«
Die gesamte kritische Nationalparkproblematik wird so naturgemäß stark verkürzt. Mit der Eröffnungsfrage werden die Befragten mit dem unverfänglichen, positiv besetzten aber inhaltlich komplett unscharfen Begriff „Naturwald“ schon auf eine entsprechend positive Antwort in der Nationalparkfrage vorbereitet. Ein alter Trick, wenn man eine bestimmte Antwort provozieren möchte. Hat sich der Antwortende in der ersten Frage bereits tendenziell festgelegt, wird er im weiteren Verlauf auf dieser Linie bleiben.
Hätte man zunächst gefragt, ob die Befragten gerne Produkte aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz nutzen würden und dann, ob grundsätzlich eher Holz importiert werden sollte oder man die heimischen Wälder nachhaltig nutzen solle und schließlich, ob durch die Schaffung eines Nationalparks die Holznutzung in der Region großflächig verboten werden sollte, man hätte sicher andere Zustimmungswerte für den Nationalpark im Steigerwald erzielt.
- Fakt ist, dass zum Nationalpark auch unbequeme Folgen für die Region und die Menschen gehören würden. Dazu gehören Arbeitsplatzverluste im ländlichen Raum.
- Waldschäden durch unterlassenen klimagerechten Waldumbau und unkontrollierte Schädlingsvermehrung mit Waldzerstörung im Nationalpark und für die anliegenden privaten Waldbauern.
- hohe Kosten für die Verwaltung.
Der Steigerwald selbst ist zudem unter dem Label „Naturpark Steigerwald“ touristisch gut erschlossen und wird viel besucht. Und was den Naturschutz angeht ist das Gebiet durchzogen von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Vogelschutzgebieten und Flora-Faune Habitaten. Für den zentral betroffenen Staatswald im Steigerwald wurde das integratives Naturschutzkonzept im bewirtschafteten Wald in diesem Jahr unter die 10 besten Waldökosysteme gewählt und vom Bundesumweltministerium sowie dem Bundesamt für Naturschutz ausgezeichnet.
Wieviel mehr würde also das „Label“ Nationalpark im Steigerwald für den Fremdenverkehr und die Biodiversität wirklich bringen?
Die Diskussion um den Nationalpark im Steigerwald ist schon so alt, dass beide Seiten alle Argumente schon vielfach ausgetauscht haben, daran ändern auch Umfragen nichts. Umfragen sind zudem keine guten politischen Ratgeber. Entscheidend ist die richtige Entscheidung nach Abwägung aller Argumente. Die bayerische Staatsregierung hatte sich entschieden und der Einrichtung eines dritten Nationalparks und weiteren Waldnutzungsverboten in Bayern aus guten Gründen eine Absage erteilt; die Grünen haben die Einrichtung des Nationalparks in ihr Programm für die anstehenden Landtagswahlen aufgenommen.

Idylle oder Ideologie? Ein weiterer Nationalpark in Bayern.