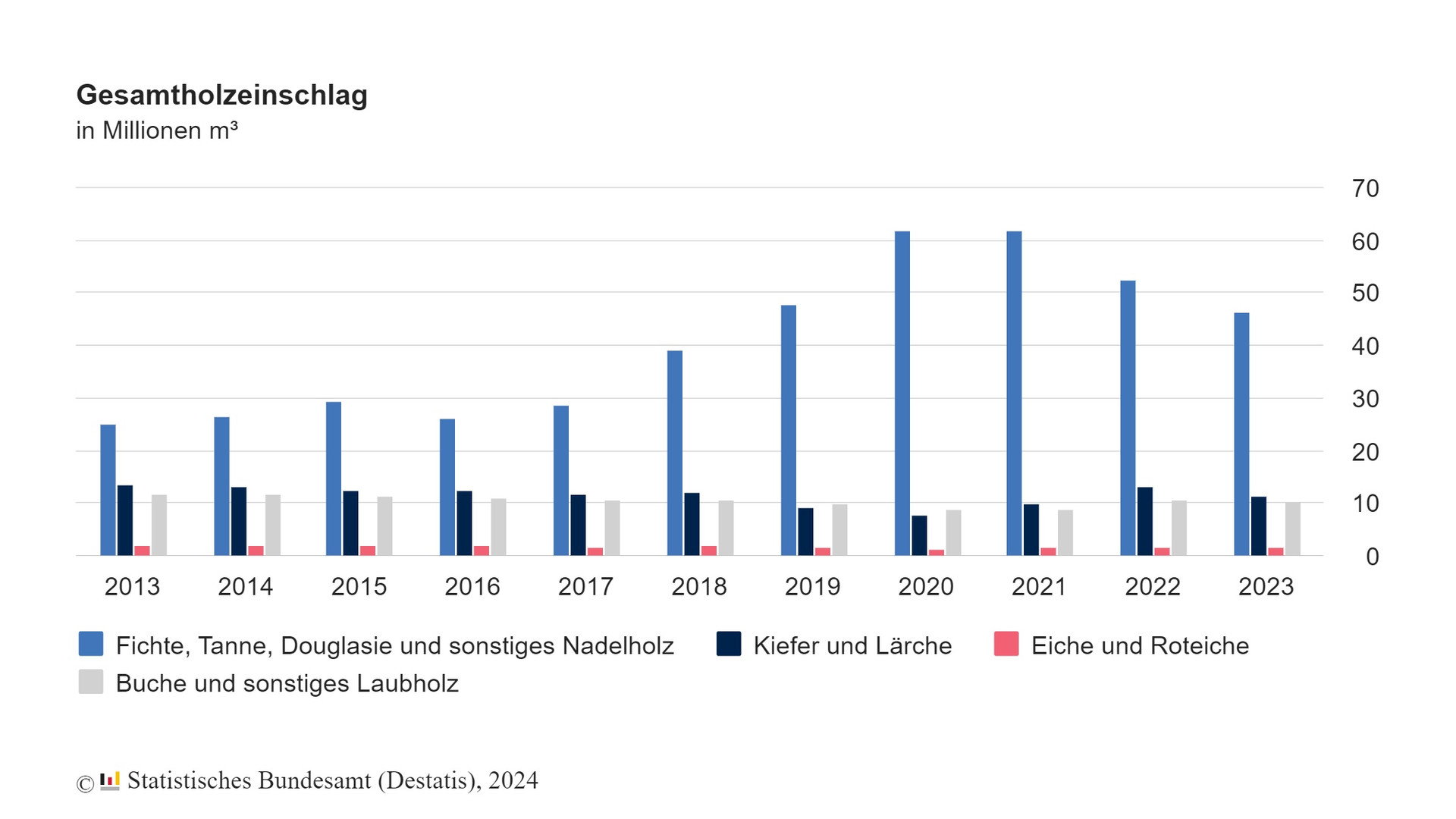NRW: Kein Nationalpark Egge
Nach dem Kreis Höxter haben sich auch die Bürger im Kreis Paderborn gegen einen Nationalpark Egge entschieden. Damit schien das Thema vom Tisch.
Kreis Paderborn. Die CDU im Kreis Paderborn und besonders Landrat Christoph Rüther (CDU) hatten während des Bürgerentscheids mit der Alternativ-Idee eines „Naturpark plus“ geworben. So könnte der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge in ein solches Konstrukt umgewandelt werden.
Naturpark plus: Ein Naturpark sei nach dem Bundesnaturschutzgesetz ein großräumiges Gebiet, das überwiegend aus Natur- und Landschaftsschutzgebieten bestehe. Er weise eine große Arten- und Biotopvielfalt sowie eine vielfältig genutzte Landschaft auf. „Ein Naturpark bewahrt und entwickelt Natur und Landschaft mit und für Menschen. Er schafft Akzeptanz für den Naturschutz sowie eine nachhaltige Entwicklung und fördert die regionale Identität“, erläutert Rüther.
Und hier könnte der Kreis Paderborn eine Vorreiterrolle einnehmen, ist der Landrat überzeugt: „Ein bislang noch nicht realisierter Naturpark Plus bietet große Chancen, zumal wir hier als Pionier unterwegs wären.“
Weitere Informationen finden Sie hier